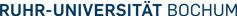2.2 Das Blatt
2.2.1 Was ist ein Blatt, Versuch einer Definition
2.2.5 Formen des Blattrandes und des Randes von Teilblättern
2.2.9 Was aussieht wie ein ganzes Blatt, aber nur ein Teil davon ist
2.2. Das Blatt
2.2.1 Was ist ein Blatt, Versuch einer Definition
Blätter sind Strukturen begrenzten Wachstums, die in fortschreitender spiraliger Folge oder in der Alternanz_ und Äquidistanzregel folgenden Wirteln unmittelbar an einem Scheitelmeristem entstehen. Eine Struktur kann auch dann als Blatt bezeichnet werden, wenn sie das letzte Glied einer solchen fortschreitenden Folge ist und mit den vorausgehenden in Mophologie und Morphogenie übereinstimmt (Qualitätskriterium) oder mit diesen eine morphologische Reihe bildet (Stetigkeitskriterium). Notfalls kann eine Struktur auch dann als Blatt betrachtet werden, wenn sie zwar keinem dieser drei Kriterien genügt (Hauptkriterien nach Remane) aber in gleicher Weise bei sicher verwandten Taxa vorkommt und dort mindestens einem der Hauptkriterien genügt (1. Hilfskriterium nach Remane).
Nach dieser Definition können Blätter nicht nachträglich zwischen bereits vorhandene Blätter eingeschoben werden, da sie dann nicht mehr unmittelbar am Scheitelmeristem entstehen würden. Das Scheitelmeristem kann sich auch nicht in eine Blattanlage umwandeln, d.h. ein Blatt kann niemals im strengen Sinn terminal stehen. Die Anatomie des Blattes spielt für seine Definition überhaupt keine Rolle, nur der Ort der Entstehung und die streng spitzenwärts fortschreitende Ausgliederungsfolge sind wesentlich. Zum 1. Teil der Definition gehört auch, daß nach einem Blatt mindestens ein weiteres Blatt gebildet wird, daß also das Scheitelmeristem nach der Bildung des Blattes seine Tätigkeit nicht einstellt. Nur in diesem Fall liegt eine fortschreitende Folge vor. Nach der hier gegebenen Definition kann ein Blatt niemals terminal an einer Achse stehen. Das letzte Blatt an einer Achse wird durch den 2. Teil der Definition erfaßt. Ein Blatt kann nach dieser Vorstellung nur sekundär in eine terminale Position geraten, indem der Scheitel bei seiner Bildung völlig aufgebraucht wird und später nicht mehr nachweisbar ist. Als Beispiel für bis zur Unkenntlichkeit reduzierte Scheitel können die Vegetationsscheitel mancher Monocotyledonen_Embryonen gelten. Die Tatsache, daß sich bei der Keimung ein normaler Vegetationsscheitel reorganisiert, kann als Beweis dafür gewertet werden, daß ein Scheitel vorhanden sein kann, auch ohne daß man ihn morphologisch oder anatomisch nachweisen kann.
In Ausnahmefällen und nur, wenn der Vegetationsscheitel sein weiteres Wachstum endgültig einstellt, kann ein Achselsproß in der Achsel des obersten Blattes direkt am Vegetationsscheitel gebildet werden. Obwohl ein solcher Sproß direkt am Vegetationsscheitel gebildet wird, ist er auch nach der oben genannten Definition kein Blatt, da er nicht Teil eines ununterbrochenen, akropetal fortschreitenden und direkt am Scheitel entstehenden Musters ist. Entweder tragen die vorausgehenden Blätter keine Achselsprosse, oder ihre Achselsprosse wurden erst nach dem folgenden Blatt gebildet.
2.2.2 Verschiedene Blätter
Folgeblätter sind Blätter, die in der Blattfolge auf reduzierte Primär-
oder Niederblätter folgen. Fruchtblätter (Karpelle, Makrosporophylle) sind die Blätter von Angiospermen,
an denen Samenanlagen gebildet werden, die mit Blättern, an denen Samenanlagen stehen in einem Wirtel stehen
oder die am Sproß auf Blätter mit Samenanlagen folgen.
Hochblätter (=Brakteen , Hypsophylle) sind auf normale Laubblätter
folgende und von den normalen Laubblättern abweichend gestaltete Blätter,
die der blütentragenden Region angehören. Sie können stark reduziert sein,
damit sie die Schauwirkung der Blüten nicht beeinträchtigen, oder selbst
Schaufunktion haben und dann groß und auffällig sein. Hochblattartige (brakteose)
Vorblätter werden auch als Brakteolen bezeichnet.
Hüllblätter sind Hochblätter die alleine (Spatha z.B. bei Aronstabgewächsen
oder Palmen) oder zu mehreren (z.B. Alliaceae, Amaryllidaceae, Asteraceae)
einen Blütenstand oder (seltener) eine Einzelblüte umgeben. Die Hüllblätter
eines Blütenstandes zusammen bilden das Involucrum die Hüllblätter
einer Einzelblüte mit gegliederter Blütenhülle nennt man Außenkelch .
Keimblätter (Cotyledonen ) sind die Blätter des ersten Blattwirtels,
die bereits innerhalb der Samenschale ausgebildet werden. Der Begriff wurde
ursprünglich für die Dikotyledonen geprägt, wo die beiden Keimblätter einen
deutlichen Gestaltunterschied zu den darauf folgenden Blättern aufweisen.
Kelchblätter (Sepalen , sing. Sepalum) sind die äußeren Blätter einer gegliederten Blütenhülle.
Kronblätter (Blütenblätter ) sind die inneren Blätter einer
gegliederten Blütenhülle (Petalen , sing. Petalum) oder alle
Blätter einer ungegliederten Blütenhülle (Tepalen, sing. Tepalum ).
Laubblätter sind grüne, meist flächig ausgebildete Blätter, die nicht
Teil der Blütenhülle sind, i.A. einfach "Blatt" genannt.
Mikrophylle und Makrophylle (=Megaphylle) sind kleine
und große Blätter. Die beiden Begriffe werden in der Regel nur im Zusammenhang
mit bestimmten Überlegungen für die Evolution des Blattes verwendet. Dabei
wird angenommen, daß das Mikrophyll (z.B. das Blatt der Bärlappe) einer
Emergenz entspricht (Enations_Theorie). Das Makrophyll ist nach dieser Vorstellung
dagegen durch gabelige Verzweigung der Achse entstanden, wobei viele Gabeläste
in eine Ebene zusammenrücken (Telomtheorie). Wer von Mikro_ und Makrophyllen
redet, unterstellt in der Regel eine polyphyletische Entstehung dieser beiden
Typen von Blättern.
Schildblätter (peltate Blätter) sind Blätter bei denen der Blattstiel
des fertigen Blattes mitten auf der Blattfläche ansetzt. In der Regel setzt
er dabei auf der Dorsalseite an, ein solches Schildblatt wird epipeltat
genannt. Setzt der Blattstiel dagegen auf der Ventralseite an, so wird das
Blatt als hypopeltat bezeichnet. Ontogenetisch entstehen Schildblätter aus
normalen Blattanlagen. Die meristematischen Ränder greifen im Verlauf der
Morphogenese auf der Ventralseite
(epipeltates Blatt) oder der Dorsalseite (hypopeltates Blatt) über den Blattstiel
hinweg und vereinigen sich zu einem ringförmig geschlossenen Meristem. Bei
diesem Vorgang werden Zellen in der Nachbarschaft des Randmeristems zu meristematischer
Aktivität angeregt, die zunächst nicht selbst meristematisch waren. Dieser
Prozess wird Meristem_Inkorporation genannt. Die Verbindung der beiden Meristeme
über dem Blattstiel wird als Meristemfusion bezeichnet. Die danach quer
über den Blattstiel verlaufende meristematische Zone heißt Querzone.
Niederblätter (=Cataphylle) sind Blätter an der Basis einer Pflanze
oder an der Basis einer Sproßgeneration oder eines Jahrestriebes, z.B. Knospenschuppen.
Zum Zeitpunkt ihrer Bildung stehen sie zwar wie alle Blätter direkt an der
Sproßspitze, es folgen ihnen im Lauf der Vegetationsperiode jedoch normale
Laubblätter nach.
Primärblätter sind die ersten von einer Keimpflanze gebildeten Blätter
nach den Keimblättern. Der Begriff wird meist nur verwendet, wenn sich diese
Blätter von den folgenden Blättern in irgendeiner Weise unterscheiden. In
diesem Fall sind die Primärblätter meist kleiner oder weisen einen geringeren
Differenzierungsgrad als die folgenden Blätter auf.
Schlauchblätter und Kannenblätter entstehen wie Schildblätter,
die Schlauchform ergibt sich durch eine Vorstülpung des Randes. Die Innenseite
der Kanne entspricht dabei im Regelfall (epipeltates Schlauchblatt) der
Blattoberseite (Ausnahme Cephalotus mit hypopeltaten Kannen bei denen die
Innenseite der Blattunterseite entspricht). Schlauchblätter sind meist spezialisierte
Fangorgane von insektivoren Pflanzen, seltener Nektarien (Markgravia).
Spelzen sind stark reduzierte trockenhäutige Hochblätter im Bereich
der Infloreszenz, z.B. bei Gräsern. Gelegentlich werden auch ähnlich gestaltete,
sehr kleine Kronblätter als Spelzen bezeichnet (z.B. bei Juncaceen). Monocotyledonen
mit solchen Merkmalen wurden in der Vergangenheit manchmal als Glumiflorae
(=Spelzenblütige) zusammengefaßt.
Staminodien (sing. Staminodium) sind sterile Staubgefäße, die den mit
Sporangien versehenen und Pollen bildenden Stamina an der Blütenachse unmittelbar
vorausgehen, nachfolgen oder untermischt mit ihnen stehen.
Staubblätter, ( Stamina, sing. Stamen , Mikrosporophylle) sind vielleicht
nicht oder nicht immer wirklich Blättern homolog. Manchmal wird deshalb
der morphologisch nichtssagende Begriff Staubgefäße vorgezogen.
Tragblätter (Pherophylle ) sind Blätter, die in ihrer Achsel
einen Seitensproß tragen. Übergangsblätter sind Blätter die in ihrer Gestalt zwischen Niederblättern
und Folgeblättern (=normalen Laubblättern) vermitteln.
Vorblätter (Prophylle ) sind die ersten beiden Blätter eines
Seitensprosses bei Dicotyledonen oder das erste Blatt eines Seitensprosses
bei Monocotyledonen. Dies gilt nur dann, wenn diese Blätter nicht bereits
Teil der Blütenhülle sind. Bei zwei Vorblättern die nicht am selben Knoten
stehen, wird das ältere als "_Vorblatt, das jüngere als $_Vorblatt bezeichnet. Sind die Vorblätter unterschiedlich groß,
wird das größere als +Vorblatt,
das kleinere als _Vorblatt bezeichnet.
2.2.3 Blattfolge
Einige der im vorausgehenden Abschnitt definierten Begriffe beziehen sich nicht in erster Linie auf bestimmte Eigenschaften des einzelnen Blattes, sondern auf seine Position am Sproß und relative Unterschiede zu vorausgehenden oder nachfolgenden Blättern, also auf die Position in einer Folge unterschiedlich gestalteter Blätter. Diese Begriffe gehören damit zum zweigliedrigen Bezugssystem aus Sproß und Wurzel und nicht zum dreigliedrigen Bezugssystem aus Sproßachse, Blatt und Wurzel und charakterisieren Glieder einer regelhaften Abfolge unterschiedlich gestalteter Blätter, die Blattfolge genannt wird. Beispiele für Blattfolgen sind:
Keimblätter, Niederblätter (Primärblätter), Übergangsblätter, Laubblätter (=Folgeblätter), Hochblätter Vorblätter, Niederblätter, Übergangsblätter, Laubblätter (=Folgeblätter), Hochblätter Hochblätter, Kelchblätter, Kronblätter, (Staubblätter), Fruchtblätter.
Diese drei Blattfolgen können durch weglassen einzelner Glieder beliebig modifiziert werden, eine Umkehr der Reihenfolge oder Vertauschung der Glieder ist dagegen nicht möglich. Die Glieder dieser drei Blattfolgen folgen an einer Sproßgeneration oder einem Jahrestrieb räumlich (von proximal nach distal) aufeinander. Jugendblätter und Altersblätter folgen dagegen im Lauf der Entwicklung zeitlich nacheinander. So bildet z.B. der Efeu die bekannten mehrspitzigen fingerlappigen Blätter an der Jugendform aus. Blühfähige Sprosse bilden dagegen eilanzettliche Altersblätter und können (auch bei Stecklingsvermehrung) nicht mehr zur Jugendform zurückkehren. Jugend_ oder Altersblätter können im Gegensatz zu den Gliedern der räumlichen Blattfolge über mehrere Vegetationsperioden die einzigen Blatttypen einer Pflanze sein.
2.2.4 Verschiedene Blattformen
ungeteilt (ganz) ist ein Blatt, dessen assimilatorische Fläche nirgends
durch stielartige Abschnitte unterbrochen ist. Schließt auch fingerförmige
und fiederförmige Blätter ein. Gegensatz: zusammengesetzt.
gefiedert (pinnat) ist ein Blatt, bei dem die assimilatorische Fläche
aus einzelnen, federartig angeordneten, gestielten Teilblättchen aufgebaut
ist. Die Fortsetzung des Blattstiels wird Rachis genannt. Endet die Rachis
in einem Teilblättchen, ist das Blatt unpaarig gefiedert, endet die Rachis
nicht in einem Teilblättchen, sondern als kurze Spitze, so ist das Blatt
paarig gefiedert. Mitunter kann es schwierig sein, zu entscheiden ob ein
gefiedertes Blatt oder ein Seitensproß mit zwei Zeilen ungeteilter Blätter
vorliegt. Zwei Kriterien können hier helfen. Erstens gibt es keine terminalen
Blätter, ein unpaarig gefiedertes Blatt kann daher nie mit einem Seitensproß
verwechselt werden. Zweitens erfolgt die Verzweigung bei Samenpflanzen immer
aus einer Blattachsel, was in der Achsel eines Blattes steht, muß daher ein
Sproß sein und was einen Sproß trägt ist immer ein Blatt. Fiedern tragen
nie Verzweigungen!
fiederförmig sind alle Blätter, bei denen die einzelnen Abschnitte
zwar wie beim gefiederten Blatt angeordnet sind, aber an ihrer Basis nicht
vollständig getrennt sind. In der Reihe fiederlappig, -spaltig, -teilig,
-schnittig nimmt die Unterteilung des Blattes stetig zu.
doppelt gefiedert (bipinnat) ist ein Blatt, wenn die Teilblätter eines
Fiederblattes selbst wiederum in einzelne gestielte Fiedern (Fiedern 2.
Ordnung) aufgeteilt sind. Sind die Fiedern 2. Ordnung selbst wieder in gestielte
Fiedern aufgeteilt, so ist das Blatt
dreifach gefiedert usw. Ein dreiteilig gefiedertes Blatt ist dagegen ein (einfach)
gefiedertes Blatt, das nur aus drei Teilblättchen besteht. gefingert (digitat) ist ein Blatt, bei dem die Stiele der Teilblättchen
nicht an einer gestreckten Rachis, sondern alle an einem Punkt ansetzen.
Dreiteilig gefingerte Blätter dürfen nicht mit dreiteilig gefiederten Blättern
verwechselt werden.
fingerförmig sind alle Blätter, bei denen die einzelnen Abschnitte
zwar wie beim gefingerten Blatt angeordnet sind, aber an ihrer Basis nicht
vollständig getrennt sind. In der Reihe fingerlappig, -spaltig, -teilig,
-schnittig nimmt die Unterteilung des Blattes stetig zu.
fußförmig (pedat manchmal irreführenderweise auch als "fußförmig gefiedert"
oder "fußförmig gefingert" bezeichnet) ist ein Blatt, bei dem gestielte oder
mit breiterm Grund ansitzende Teilblättchen den beiden einzigen Seitennerven
1. Odnung aufgereiht sind. Für die Anwendung des Begriffes "fußförmig" ist
es unwesentlich, ob die Teilblättchen gestielt sind oder mit breiter Basis
angeheftet
zusammengesetzt sind Blätter, die aus mehreren, völlig getrennten Abschnitten
bestehen, die entweder einen Stiel
aufweisen oder sich wenigstens in eine stielartige Basis verjüngen. Sammelbegriff für gefiederte, gefingerte und (manche) fußförmige
Blätter. Gegensatz: ungeteilt
2.2.5 Formen des Blattrandes und des Randes von Teilblättern
Für die Gestaltung des Blattrandes gibt es eine Fülle von kaum gegeneinander abgrenzbaren Spezialbegriffen von denen in der Praxis nur ein Teil in Gebrauch ist. Bei stark strukturierten Blatträndern läßt sich auch schlecht eine Grenze zwischen der Blattform und der Form des Blattrandes ziehen. Bestimmungsbücher und Florenwerke sind deswegen meist mit eigenen Glossarien ausgestattet, die zweckmäßigerweise zu Rate gezogen werden sollten. Eine Übersicht über alle für Pflanzenbeschreibungen verwendeten Begriffe geben Lawrence (????) und Stearn (1983).
2.2.6 Morphologie und Morphogenie des Blattes
Durch seine Entstehung seitlich am Sproßscheitel ist das Blatt von seiner Anlegung her immer bifacial. Es hat eine dem Scheitel zugewandte (adaxiale , ventrale) Seite und eine vom Scheitel abgewandte (abaxiale , dorsale) Seite, die meist aber durchaus nicht immer morphologisch und anatomisch gut unterscheidbar sind. Die Blattanlage ist aber bei ihrer Entstehung zunächst fast kegelförmig und wird erst im Verlauf der Morphogenese mehr oder weniger abgeflacht. Die Entwicklung des Blattes kann in verschiedene, mehr oder weniger gut getrennte Wachstumsphasen untergliedert werden. Die in den einzelnen Differenzierungsphasen gebildeten Teile sind in der Regel am fertigen Blatt als deutliche Abschnitte erkennbar, die mit eigenen Begriffen belegt werden. Das Oberblatt besteht aus Blattstiel und Blattspreite. Das Unterblatt besteht aus dem Blattgrund und trägt häufig paarige seitliche Anhänge, die als Stipeln bezeichnet werden. Das Unterblatt mit den gegebenenfalls vorhandenen Stipeln entwickelt sich immer sehr frühzeitig und seine morphologische Differenzierung läuft der des Oberblattes deutlich voraus. Der Blattstiel (Petiolus ) ist Teil des Oberblattes und entwickelt sich als letzter Teil des Blattes. Infolge seines interkalaren Wachstums verlaufen die Leitbündel im Blattstiel immer parallel.
Stipeln können in verschiedenen Ausprägungen vorkommen. Sie können reduziert und Sklerifiziert sein und persistieren dann meist, nachdem das laubig ausgebildete Oberblatt mit dem Blattstiel bereits abgefallen ist. Man spricht dann von Stipulardornen. Das bekannteste Beispiel hierfür sind sukkulente Euphorbien. Die beiden seitlichen Stipeln eines Blattes können aber auch mit ihren Rändern über die Ventralseite des Blattstiels hinweggreifen und zu einem einheitlichen Gebilde verwachsen, daß dann median vor dem Blattstiel steht. Man spricht in diesem Fall von einer Medianstipel (z.B. Bergenia). Bei wirteliger Blattstellung können aber auch die Stipeln benachbarter Blätter zu einem einheitlichen Gebilde verwachsen. Man spricht dann für den Fall, daß die zugehörigen Blätter einen deutlichen Blattstiel aufweisen, von Interpetiolarstipeln (z.B. Cunoniaceae), anderenfalls von Interfoliarstipeln (Galium, Außenkelch von Potentilla). Interpetiolar_ oder Interfoliarstipeln sind morphologisch einheitliche Gebilde, die aber ontogenetisch durch Verschmelzung der Anlagen je einer Stipel von zwei benachbarten Blättern entstehen. Stipeln können per Definition nur an der Basis des Blattes, nicht aber an der Basis von Teilblättern (z.B. Fiedern) auftreten. Stipelähnliche Bildungen an der Basis von Teilblättern werden deswegen Stipellen genannt (z.B. Thalictrum).
Üblicherweise sind Oberseite und Unterseite des Blattes verschieden gestaltet. Sie sehen bereits oberflächlich betrachtet unterschiedlich aus und zeigen diesen Unterschied auch im anatomischen Bau, das Blatt wird deswegen als bifacial bezeichnet. Das typische Blatt muß als Assimilationsorgan einerseits möglichst viel Chloroplasten dem Licht exponieren, andererseits auch Transportaufgaben bewältigen. Vernünftigerweise wird die Exposition von Chloroplasten konzentriert nahe der Blattoberfläche vorgenommen, während Gewebe für Transportaufgaben unter dieser Schicht angeordnet sind. Das Abschlußgewebe selbst, die Epidermis, ist meist chlorophyllfrei. Nur die Schließzellen der Spaltöffnungen enthalten grundsätzlich Chloroplasten. Unter der oberen Epidermis liegen palisadenförmige Zellen mit vielen Chloroplasten dicht beieinander. In diesem Palisadengewebe sind die meisten Chloroplasten lokalisiert. Blätter, die hohen Lichtintensitäten ausgesetzt sind, können mehrere Lagen von Palisadenparenchym aufweisen. Dabei kann mehrschichtiges Palisadenparenchym arttypisch sein (d.h. bei allen Blättern einer Art auftreten), oder es kann auf die stark lichtexponierten Blätter (Sonnenblätter) beschränkt sein und die weniger exponierten Blätter (Schattenblätter) weisen dann nur eine Lage Palisadenparenchym auf. Für den Gasaustausch steht unter dem Palisadenparenchym ein interzellularenreiches, sog. Schwammparenchym zur Verfügung, das über Spaltöffnungen in der unteren Epidermis mit der Aussenluft kommuniziert. Wegen dieser Anordnung und Ausgestaltung von Palisaden_ und Schwammparenchym kommen Spaltöffnungen normalerweise nur auf der Blattunterseite vor. Solche Blätter nennt man hypostomatisch. Vor allem bei Arten schattiger und feuchter Standorte kommt es vor, daß die Blätter im Bereich des Blattstiels oder in der Spreitenbasis gedreht sind und die Unterseite nach oben weisen, solche Blätter sind resupinat. Manche Blätter exponieren allerdings nicht bevorzugt die Oberseite dem Licht, sondern beide Seiten werden mehr oder weniger gleichmäßig belichtet. Beispiele hierfür sind viele senkrecht stehenden Blätter z.B. bei Gräsern, Lauch oder Tulpen. Bei solchen Blättern wird die Zonierung des normalen Blattes unzweckmäßig, und tatsächlich weichen viele dieser Arten vom normalen Blattbau ab. Palisadenparenchym und Schwammparenchym sind nicht mehr deutlich differenziert und es treten auch auf der Oberseite des Blattes Spaltöffnungen auf, die Blätter werden amphistomatisch. Oberseite und Unterseite werden einander immer ähnlicher, das Blatt wird aequifacial. Auch wenn Oberseite und Unterseite beim aequifacialen Blatt gleich aussehen, können sie meist anhand anatomischer Merkmale eindeutig identifiziert werden. So ist bei kollateralen Leitbündeln das Xylem immer zur Obeseite und das Phloem zur Unterseite hin orientiert.
Der Aufbau des Blattes kann auch in entscheidenden Merkmalen umgekehrt wie beim normalen Blatt sein. So sind z.B. Spaltöffnungen auf der Unterseite von Schwimmblättern nutzlos. Solche Blätter sind bifacial und tragen die Spaltöffnungen meist auf der Oberseite, sie werden als epistomatisch und invers bezeichnet.
Es kann jedoch vorkommen, daß Blätter keinen zweiseitigen Aufbau mehr erkennen lassen. Im Querschnitt kann man sie von einer Sproßachse nicht unterscheiden, nur durch die Anlegungsweise und das begrenzte Wachstum erweisen sie sich als Blätter. Solche Blätter sind praktisch immer drehrund. Weil sie keinerlei Differenzierung in Oberseite und Unterseite zeigen, nennt man sie unifacial.
Da bei den Leitbündeln im Stamm das Xylem innen und das Phloem außen liegt, muß beim Auszweigen in das Blatt zwangsläufig das Xylem zur Blattoberseite hin und das Phloem zur Blattunterseite hin orientiert sein. Die Nervatur ist ein guter Indikator für die Art und Weise des Blattwachstums. Bei reinem Randwachstum können keine geschlossenen Randnerven entstehen, die Nervatur bleibt völlig offen (z.B. Ginkgo). Bei Flächenwachstum entsteht eine mehr oder weniger deutliche Netznervatur mit meist geschlossenen Randnerven. Bei einem reinen interkalaren Wachstum entstehen parallel_ oder streifennervige Blätter (die meisten Monocotyledonen). Wo Hauptnerven und Seitennerven unterschiedliche Muster bilden, deutet dies darauf hin, daß sie in unterschiedlichen Wachstumsphasen gebildet wurden.
Studien über die frühen Wachstumsabläufe zeigen, daß es für typische Dikotyledonen und typische Monocotyledonen eine jeweils charakteristische Abfolge von Wachstumsprozessen gibt, die zu den bekannten Unterschieden der Blattgestalt dieser beiden Gruppen führt. Bei den Dikotyledonen beginnt die Blattdifferenzierung mit Spitzenwachstum. Daran schließt sich Blattprimordiums früh eine Differenzierung in einen distalen und einen proximalen Teil an. Im distalen Bereich kann das Spitzenwachstum noch anhalten und eine sog. Vorläuferspitze gebildet werden. Beide Teile zeigen noch während des Spitzenwachstums oder darauf zunächst ein mehr oder weniger ausgeprägtes Wachstum der lateralen Bereiche, so daß ein Randmeristem entsteht, das zu flächiger Ausbildung der Blattanlage führt. Der proximale Bereich, der Blattgrund mit den Stipeln, eilt dabei dem distalen Bereich in seiner Entwicklung voraus, er hat seine endgültige Form vor dem distalen Bereich erreicht. In der Phase typischen Randwachstums werden die Hauptnerven gebildet. Danach schließt sich ein Flächenwachstum vor allem des distalen Teiles an. Die Gewebedifferenzierung der Lamina erfolgt gleichmäßig über die ganze Blattfläche. Die gebildeten Flächen werden durch netzartig verzweigte Leitbündel von den bereits bestehenden Leitbündeln aus versorgt. Erst relativ spät in der Morphogenie setzt ein interkalares Längenwachstum an der Grenze zwischen den beiden Bereichen ein, durch das der Blattstiel entsteht.
Bei den Monocotyledonen unterbleibt dagegen die frühe Unterteilung in einen distalen Bereich und einen proximalen Bereich. Das Blatt zeigt sehr früh an der Basis interkalares (basiplastes) Wachstum, die Differenzierung schreitet von der Spitze zur Basis fort. Durch Meristem_Inkorporation kann der Blattansatz über die gesamte Entwicklungsdauer nachträglich noch sehr stark verbreitert werden. Durch ein nachgeschaltetes Flächenwachstum, bei dem nur die Blattbreite vergrößert wird, kann der Eindruck eines normalen gestielten Blattes entstehen. Ein durch nachträgliches interkalares Wachstum zwischen zwei flächige Bereiche eingeschobener Blattstiel wie er bei den Dikotyledonen vorkommt, fehlt den Monocotyledonen.
Die Abfolge der Wachstumsphasen legt nicht nur Blattform und Blattnervatur fest. Sie ist andererseits auch Ausdruck der räumlichen Verhältnisse am Vegetationsscheitel. So treten z.B. typische Vorläuferspitzen an gestreckten, nicht über den Scheitel vorgewölbten Blattanlagen auf. Da eine gerollte oder längs gefaltete Lage der Blätter in der Knospe immer eine aufrechte Stellung der Blattspitze bedingt, ist die Bildung von Vorläuferspitzen bei Blättern mit convoluter oder conduplicativer Knospenlage besonders häufig. Einzelne Bereiche des Blattes können zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Funktionen wahrnehmen. Beispiele hierfür sind der Knospenschutz durch Blattbasen älterer Blätter (Unterblatt und/oder Stipeln) und durch Vorläuferspitzen jüngerer Blätter an ein und derselben Sproßspitze.
Wenn Blätter in der Phase, in der noch Leitbündel angelegt werden, ein reines Randwachstum aufweisen, dann haben sie eine gabelige, offene Nervatur ohne Anastomosen. Bereiche mit Flächenwachstum können eine geschlossene Nervatur und Anastomosen aufweisen, wenn in dieser Wachstumsphase noch Leitbündel neu gebildet werden. In Bereichen mit reinem interkalarem Wachstum verlaufen die Leitbündel dagegen zwangsläufig immer exakt parallel und anastomosieren niemals. Diese einfachen Sachverhalte erlauben in gewissen Grenzen, aus der Blattnervatur auf die Blattontogenie zu schließen.
2.2.7 Was so aussieht wie ein Blatt und trotzdem sicher keines ist
Manche Arten haben ihre Blätter in Anpassung an besondere Umweltbedingungen im Verlauf ihrer Phylogenie stark reduziert. Als sie in der weiteren Evolution wieder andere Lebensräume besiedelten, entwickelten sie Strukturen, die zwar Blättern ähnlich, aber nicht homolog sind.
Als Phyllokladien werden die blattartigen Flachsprosse von Spargel und Mäusedorn bezeichnet. Betrachtet man die auf den ersten Blick wie Blätter an einer Sproßachse inserierten Gebilde, so sieht man, daß sie in der Achsel eines kleinen schuppenförmigen Blattes stehen. Da bei Samenpflanzen in der Achsel eines Blattes nur ein Sproß, niemals aber ein Blatt stehen kann, muß es sich bei diesen Gebilden um blattartig umgewandelte Sprosse handeln. Phyllokladien haben aber im Gegensatz zu Platykladien ein begrenztes Wachstum und sind darin den Blättern ähnlicher als letztere. Bei Ruscus ist die Ähnlichkeit der Phyllokladien mit Blättern durch eine Differenzierung der Sprosse in blattartige und sproßartige Teile besonders täuschend.
Bei bei Flachsprossen (Platycladien) ist dies weniger der Fall. Hier tritt nur eine Sorte von blattartigen Flachsprossen auf, die sich auch im Gegensatz zum Ruscus-Flachsproß weiter verzweigt. Bekannteste Beispiele für diesen Typ sind Feigenkaktus, Osterkaktus oder die Polygonacee Muehlenbeckia platyclada (=Homalocladium platycladum). Obwohl diese Flachsprosse funktionell die Aufgabe von Blättern wahrnehmen, werden sie auch vom Anfänger kaum mit Blättern verwechselt.
Phyllokladien und Platycladien können unter dem Oberbegriff Kladodien zusammengefaßt
werden.
2.2.8 Was aussieht wie mehrere Blätter und trotzdem nur eines ist
Fiederblätter oder andere zusammengesetzte Blätter (=geteilte Blätter)
sehen auf den ersten Blick aus wie aus mehreren Blättern aufgebaute Gebilde.
Entscheidend dafür, daß sie als ein einziges Blatt betrachtet werden müssen
ist, daß sie aus einer einzigen Blattanlage entstehen. Diese Definition
ist zwar theoretisch eindeutig, praktisch aber unbefriedigend, da man i.A.
nicht die Möglichkeit hat, jedesmal ontogenetische Studien zu betreiben,
bevor man etwas als Blatt bezeichnet. Es gibt jedoch andere eindeutige Kennzeichen,
um zu entscheiden, welche Einheit ein Blatt darstellt. So können sich Samenpflanzen
ausschließlich aus der Achsel von Blättern verzweigen. Diejenige Einheit,
an deren Basis ein Achselsproß steht, ist daher immer ein einziges Blatt.
2.2.9 Was aussieht wie ein ganzes Blatt, aber nur ein Teil davon ist
Bei den Blättern von Eucalyptus_ und Acacia_Arten fällt auf, daß die Blattform
bei Jungpflanzen und bei älteren Pflanzen verschieden sein kann. Bei den
älteren Pflanzen stehen die Blätter in Profilstellung, d.h. es ist nicht
die Blattfläche zur Achse hin orientiert, sondern eine Seitenkante. Dies
kommt nicht durch Drehung im Bereich des Blattstiels zustande, sondern dadurch,
daß sich das Blatt im Bereich des Blattstiels und der Mittelrippe in der
Medianebene (also senkrecht zur üblichen Richtung) flächig erweitert und
die normalerweise in der Transversalebene ausgebreiteten Blattbereiche sind
hier reduziert. Solche Blätter, die vorwiegend aus in der Medianebene verbreiterten
Blattstielen bestehen, werden vielfach als Phyllodien bezeichnet.
2.2.10 Blatt oder nicht Blatt? Wo die Definition versagt.
Wir sind gewohnt, Staubgefäße als Blättern homolog zu betrachten und bezeichnen sie deshalb in der Regel als Staub"blätter". In manchen Fällen von sekundärer Polyandrie genügt jedoch das einzelne Staubgefäß der hier gegebenen Blattdefinition nicht. Das ist der Fall bei zentrifugalem Dédoublement, oder wenn aus einzelnen, nach den Blattstellungsregeln angelegten Primordien mehr als ein Staubgefäß gebildet wird. Auch Fälle, in denen die Staubgefäße später als die Karpelle erkennbar werden, lassen sich unter dieser Blattdefinition nicht fassen. Auf dieses Problem wird im Kapitel Mikrosporophyll und Androeceum (S. 112) näher eingegangen.
2.2.11 Metamorphosen des Blattes
Blätter können in verschiedener Weise umgewandelt sein. Sie dienen dann
ausschließlich, zusätzlich oder vorwiegend anderen Aufgaben als der Photosynthese. Die bekanntesten Metamorphosen sind Blattdornen (z.B. Berberis
vulgaris). Dabei können ganz bestimmte Teile des Blattes verdornen und so
einen wirksamen Fraßschutz bilden. Häufig sind dies die Stipeln (Stipulardornen
bei sukkulenten Euphorbiaceen) oder die Rachis von Fiederblättern (Rachisdornen
bei Astragalus). Auch zu Speicherorganen können Blätter umgewandelt sein
(z.B. in der Zwiebel). Blattranken dienen Kletterpflanzen dazu, an anderen
Pflanzen oder Gerüsten hochzuklettern. Schließlich können Blätter sukkulent
werden und in erheblichem Maß Wasser speichern. Bei manchen insektenfangenden
Pflanzen wird das Blatt zu einem kannenartigen Schlauchblatt umgewandelt,
das mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. Darin werden die ertränkten Insekten
verdaut und die gelösten Nährstoffe resorbiert. In der Regel entspricht die
Innenseite der Kanne der morphologischen Oberseite des Blattes (Nepentes,
Sarracennia, Darlingtonia etc.), nur bei Cephalotus entspricht die Innenseite
des Fangblattes der morphologischen Unterseite des Blattes. Der anatomische
Aufbau wird bei Metamorphosen unter Umständen gegenüber dem bekannten Normalfall
hochgradig abgewandelt (z.B. sukkulente Fensterblätter).